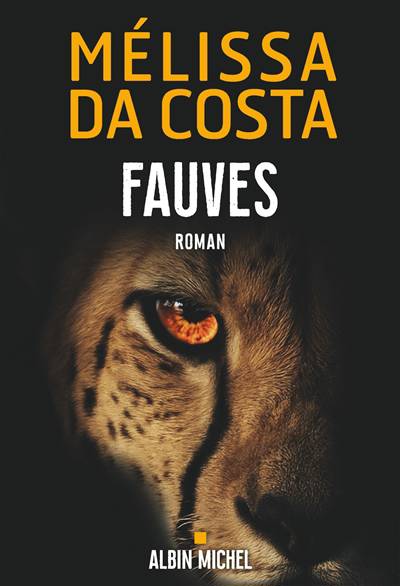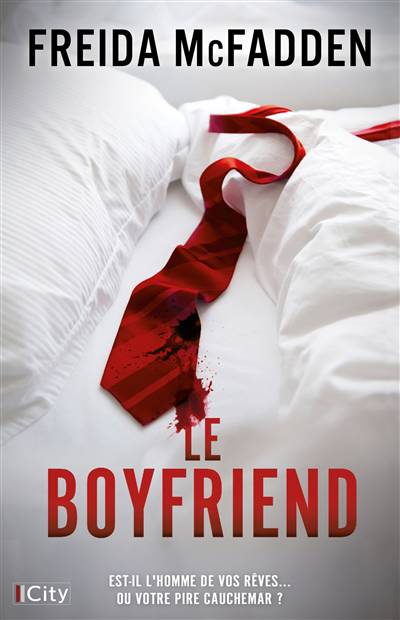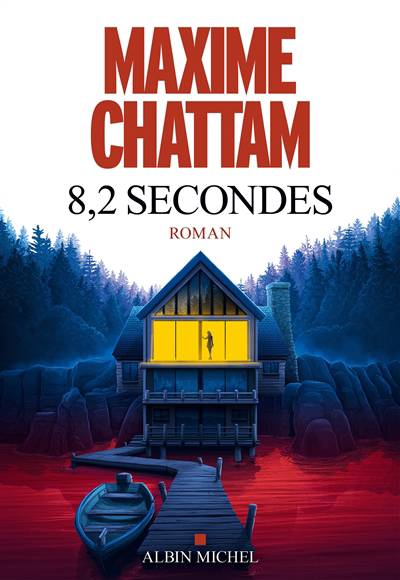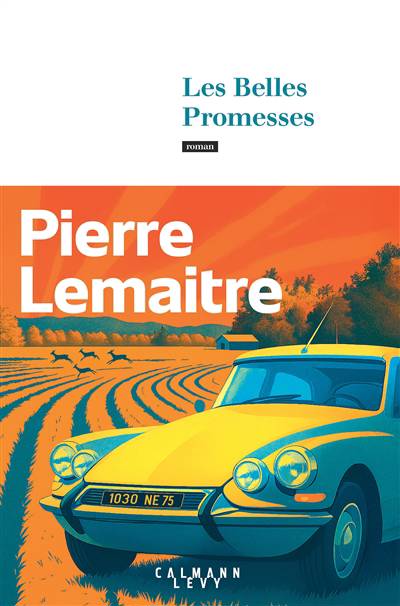
- Retrait en 2 heures
- Assortiment impressionnant
- Paiement sécurisé
- Toujours un magasin près de chez vous
- Retrait gratuit dans votre magasin Club
- 7.000.0000 titres dans notre catalogue
- Payer en toute sécurité
- Toujours un magasin près de chez vous
Zwischen "Hexenhammer" Und "Faustbuch"
Religiöses Wissen Und Ästhetische Reflexion in Der Deutschen Literatur Der Frühen Neuzeit
Paula FurrerDescription
Das dämonologische Schrifttum, das während der frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen entsteht, systematisiert religiöses Wissen unterschiedlicher Herkunft und kondensiert dieses in kurzen Erzählungen mit exemplarischer Funktion. Die Studie fragt einerseits danach, wie dämonologische Traktate narrative Verfahren und literarische Formen aufnehmen. Andererseits richtet sich das Erkenntnisinteresse darauf, inwiefern literarische Texte religiöses Wissen aus den Dämonologien in ihre Narration integrieren. Zentral ist dabei das ästhetische Potenzial der dämonischen Illusion, die sowohl diskursiv als auch narrativ innerhalb der Dämonologie und in literarischen Texten verhandelt wird.
Beginnend mit dem Malleus Maleficarum (1486/87) verfolgt die Arbeit die Problemstellung über einen Zeitraum von hundert Jahren anhand exemplarischer Texte u.a. von Hans Sachs, Johann Weyer, Jean Bodin, Johann Fischart und entlang der Historia von D. Johann Fausten (1587).
Die literaturwissenschaftliche Perspektive zeigt die Bedeutung literarischen Formenwissens für den frühneuzeitlichen dämonologischen Diskurs und zeichnet eine andere Geschichte der ästhetischen Illusion nach, die nicht von ihrer genuin kunstreflexiven Seite, sondern ausgehend von ihrem dämonischen Ursprung dargelegt wird.
Spécifications
Parties prenantes
- Auteur(s) :
- Editeur:
Contenu
- Nombre de pages :
- 280
- Langue:
- Allemand
- Collection :
- Tome:
- n° 18
Caractéristiques
- EAN:
- 9783119144018
- Date de parution :
- 03-11-25
- Format:
- Livre relié
- Format numérique:
- Genaaid
- Dimensions :
- 170 mm x 240 mm
- Poids :
- 498 g

Seulement chez Librairie Club
Les avis
Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.